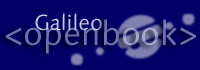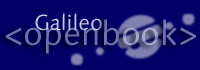16.7 IPv6 für Java mit Jipsy  Bis zur Java-Version 1.4 unterstützt die Java-Bibliothek nur IPv4, also Netzwerkadressen, die sich durch vier Oktette auszeichnen. Anfang 1970 fanden die Entwickler 32-Bit-IP-Adressen mehr als genug, doch es reichte nicht. Mit IPv6, auch bekannt als IPng (IP Next Generation), existiert eine Erweiterung des IP-Verkehrs, so dass IP-Adressen keinen Engpass mehr darstellen. Für IPv6 hat die Arbeitsgruppe voll zugelangt und 128 Bits eingeplant.
Ist für die älteren Java-Versionen IPv6 gefragt, dann füllt die Software Jipsy von Matthew Flanagan die Lücke. Seine Implementierung ersetzt die IPv4-lastigen Klassen im java.net-Paket einfach durch neue. Ohne Änderung des Programmcodes und unter Einbeziehung einer externen nativen Bibliothek ist der Schritt leicht gemacht. Dennoch lässt Jipsy die neue Schreibweise für Adressen zu. Während bei IPv4 die vier Bytes durch Punkte getrennt wurden, entstehen nun Adressen folgenden Formats:
4B23:12FA:667C:3621:9819:00A1:0044:CAFE
Eine IPv6-Adresse besteht aus acht Gruppen von jeweils vier Hexadezimalzeichen.
Die letzte Version von Jipsy lässt sich unter http://sourceforge.net/projects/jipsy/ beziehen. Nach dem Auspacken erhalten wir die Klassen und den Quellcode. Jipsy ist Open Source, genauer gesagt, es steht unter GNU Lesser General Public License (LGPL). Flanagan implementiert die Klassen direkt ins Paket java.net, so dass wir der Laufzeitumgebung nur noch über den CLASSPATH die neuen Klassen mitteilen müssen. Zudem muss natürlich auch auf die native Bibliothek verwiesen werden, unter Unix, indem wir den Pfad zu libnet6.so zur Variablen LD_LIBRARY_PATH hinzufügen. Der beigelegten Datei install sind weitere Informationen zu entnehmen.
Die Implementierung ist natürlich plattformabhängig, und so lässt sich nicht auf jeder Plattform IPv6 nutzen. Voraussetzung ist selbstverständlich, dass das Betriebssystem die nächste Generation der IP-Dienste nutzen kann.
|